Tagungen
Nachlese zur 33. Sächsische Holzschutztagung am 15. März 2025 in Dresden
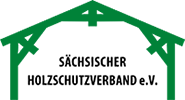
Sächsische Holzschutztagung unterstreicht Notwendigkeit von Holzschutz in Bestands- und Neubauten
 Am 15. März 2025 fand im Konferenzgebäude des Instituts für Holztechnologie Dresden die 33. Sächsische Holzschutztagung statt. Die insgesamt 90 angemeldeten Planer, Sachverständigen und Ausführenden erwarteten u. a. neue Erkenntnisse bei der Feststellung eines Insektenbefalls und dessen Bekämpfung z. B. bei älteren Bauwerken, aber auch Hinweise und Vorschläge bei der Erstellung neuer Holzhausbauten.
Am 15. März 2025 fand im Konferenzgebäude des Instituts für Holztechnologie Dresden die 33. Sächsische Holzschutztagung statt. Die insgesamt 90 angemeldeten Planer, Sachverständigen und Ausführenden erwarteten u. a. neue Erkenntnisse bei der Feststellung eines Insektenbefalls und dessen Bekämpfung z. B. bei älteren Bauwerken, aber auch Hinweise und Vorschläge bei der Erstellung neuer Holzhausbauten.
Akustische Detektion holzzerstörender Insekten
Ein vorhandener Insektenschaden wirft immer die Frage nach der Befallswahrscheinlichkeit auf, denn nur ein aktiver Befall muss bekämpft werden. Eine Möglichkeit, diesen zu erkennen, ist bei Hausbocklarven schon immer die Wahrnehmung der Fraßgeräusche gewesen. Während Fraßgeräusche von den größeren Hausbocklarven u. U. ohne technische Hilfsmittel geortet werden können, ist das bei den kleineren Larven von Gewöhnlichem Nagekäfer oder gar Splintholzkäfer ohne technische Hilfsmittel unmöglich. In den vergangenen Jahrzehnten sind mehrere Techniken zu Detektionsversuchen entwickelt worden, was aber lediglich bei Hausbock und Termiten Erfolg zeigte.
 Stefan Biebl (Ingenieurbüro für Holzschutz Benediktbeuern) stellte in seinem Vortrag die Schallemissionsprüfung (englisch: Acoustic Emission „AE“) vor, die in Industrie und Bauwesen zur Überprüfung von Druckbehältern oder auch zur Überprüfung von Spannbetonbrücken angewendet wird. Mit dieser Methode lassen sich auch Körperschallemissionen aktiver Insektenlarven visualisierbar machen. Das in Zusammenarbeit mit Vallen Systems entwickelte mobile IADS-Gerät (IADS = insect activity detection system) zeigt in der Praxis gute Ergebnisse bei Larven des Gewöhnlichen Nagekäfers sowie der Splintholzkäfer. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein aktiver Befall kann sofort ermittelt werden. Weitere Untersuchungen zur gezielten Umsetzung in die Praxis sind noch nötig, um die optimale Nutzung des Produktes zu erreichen.
Stefan Biebl (Ingenieurbüro für Holzschutz Benediktbeuern) stellte in seinem Vortrag die Schallemissionsprüfung (englisch: Acoustic Emission „AE“) vor, die in Industrie und Bauwesen zur Überprüfung von Druckbehältern oder auch zur Überprüfung von Spannbetonbrücken angewendet wird. Mit dieser Methode lassen sich auch Körperschallemissionen aktiver Insektenlarven visualisierbar machen. Das in Zusammenarbeit mit Vallen Systems entwickelte mobile IADS-Gerät (IADS = insect activity detection system) zeigt in der Praxis gute Ergebnisse bei Larven des Gewöhnlichen Nagekäfers sowie der Splintholzkäfer. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein aktiver Befall kann sofort ermittelt werden. Weitere Untersuchungen zur gezielten Umsetzung in die Praxis sind noch nötig, um die optimale Nutzung des Produktes zu erreichen.
Schlupfwespen gegen den Nagekäfer
Ein vorhandener Insektenbefall ist zwar nicht wünschenswert und sollte nach dem Willen der Auftraggeber schnellstmöglich für immer beseitigt werden, was allerdings nicht realitätsnah ist. Bekämpfungsmaßnahmen werden durchaus vollumfänglich angestrebt, erfordern jedoch unter Umständen einen umfangreichen Zeitrahmen mit entsprechender Beobachtung.
 Gerd Wapler (monumentconsult GmbH, Isen) erläuterte in seinem Vortrag die Möglichkeit, Schlupfwespen (Spathius exarator) gegen den Gewöhnlichen Nagekäfer einzusetzen. In der Erzdiözese München-Freising wurde ein Forschungsprojekt zur Wirksamkeit in der Praxis angestrebt. In insgesamt 15 Kirchen mit 193 Referenzflächen sollte die Veränderung der Befallsstärke nach mehrmaligem Schlupfwespeneinsatz geprüft werden. In dem fünfjährigen Projekt wurden verschiedene Monitoringmethoden zwecks Erfassung der jahresbezogenen Ausfluglöcher von Nagekäfern und Schlupfwespen eingesetzt. Da in 12 von 15 Kirchen ein natürliches Vorkommen von Schlupfwespen (Spathius exarator) nachgewiesen wurde, konnte auf ein ausreichendes Vorhandensein von Nagekäferlaven geschlossen werden. Es konnte eine deutliche Reduzierung der Larven des Gewöhnlichen Nagekäfers nachgewiesen werden. Da die Schlupfwespen von Kirchenbesuchern kaum bemerkt werden, wird diese Maßnahme auch nicht als störend empfunden. Neben anderen Methoden der Bekämpfung holzzerstörender Insekten kann die Schlupfwespenbehandlung durchaus in Zukunft einen Beitrag zum Erhalt von Holzobjekten und Kunstwerken in Kirchen leisten. Ob als Einzelmaßnahme oder als Teil eines Gesamtkonzeptes – eine sachkundige Beurteilung und Begleitung ist bei allen Schritten unabdingbar.
Gerd Wapler (monumentconsult GmbH, Isen) erläuterte in seinem Vortrag die Möglichkeit, Schlupfwespen (Spathius exarator) gegen den Gewöhnlichen Nagekäfer einzusetzen. In der Erzdiözese München-Freising wurde ein Forschungsprojekt zur Wirksamkeit in der Praxis angestrebt. In insgesamt 15 Kirchen mit 193 Referenzflächen sollte die Veränderung der Befallsstärke nach mehrmaligem Schlupfwespeneinsatz geprüft werden. In dem fünfjährigen Projekt wurden verschiedene Monitoringmethoden zwecks Erfassung der jahresbezogenen Ausfluglöcher von Nagekäfern und Schlupfwespen eingesetzt. Da in 12 von 15 Kirchen ein natürliches Vorkommen von Schlupfwespen (Spathius exarator) nachgewiesen wurde, konnte auf ein ausreichendes Vorhandensein von Nagekäferlaven geschlossen werden. Es konnte eine deutliche Reduzierung der Larven des Gewöhnlichen Nagekäfers nachgewiesen werden. Da die Schlupfwespen von Kirchenbesuchern kaum bemerkt werden, wird diese Maßnahme auch nicht als störend empfunden. Neben anderen Methoden der Bekämpfung holzzerstörender Insekten kann die Schlupfwespenbehandlung durchaus in Zukunft einen Beitrag zum Erhalt von Holzobjekten und Kunstwerken in Kirchen leisten. Ob als Einzelmaßnahme oder als Teil eines Gesamtkonzeptes – eine sachkundige Beurteilung und Begleitung ist bei allen Schritten unabdingbar.
Baufeuchtemanagement beim Geschossbau von Holzbauten
Ausgehend von DIN 68800-1 beschreibt der Begriff Holzschutz in der heutigen Zeit die Anwendung von „Maßnahmen, die eine Wertminderung oder Zerstörung von Holz und Holzwerkstoffen besonders durch Pilze, Insekten oder Meerestiere verhüten sollen und damit eine lange Gebrauchsdauer sicherstellen“. Hiermit ist in erster Linie der baulich-konstruktive Holzschutz gemeint. Veränderungen im Holzbau sind dahingehend anzutreffen, dass Gebäude zunehmend aus Holz gebaut werden. Offensichtlich nimmt auch die Größe der Gebäude zu. Pilzschäden an Holzkonstruktionen sind immer die Folge von zu hoher Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist und nicht schnell genug oder gar nicht abgeleitet wurde. Da Feuchteschäden eine sehr große Gefahr für das Holzbauwerk sind, muss sich ein Planer zuerst mit der Frage befassen, wie die Holzkonstruktion während der Bauphase zu schützen ist.
 Michael Förster (proclima, Schwetzingen) verwies in seinem Vortrag auf bekannte Normen und Regelwerke, die wichtige Informationen z. B. zur Qualitätssicherung an Holzbauwerken enthalten. Die Erstellung eines Witterungsschutzkonzeptes sollte unvorhersehbare Wetterereignisse nicht außer Acht lassen, denn bei Notfallmaßnahmen muss umgehend reagiert werden können. Obwohl die Vorteile eines exquisiten Bauwerksschutzes (z. B. durch Schutzdächer ab Beginn der Arbeiten) bekannt, aber teuer sind, wird öfter mit einem Bauteilschutz gearbeitet. Optimal ist das Aufbringen von Bauteilschutzmaterialien bereits in der Vorfertigung.
Michael Förster (proclima, Schwetzingen) verwies in seinem Vortrag auf bekannte Normen und Regelwerke, die wichtige Informationen z. B. zur Qualitätssicherung an Holzbauwerken enthalten. Die Erstellung eines Witterungsschutzkonzeptes sollte unvorhersehbare Wetterereignisse nicht außer Acht lassen, denn bei Notfallmaßnahmen muss umgehend reagiert werden können. Obwohl die Vorteile eines exquisiten Bauwerksschutzes (z. B. durch Schutzdächer ab Beginn der Arbeiten) bekannt, aber teuer sind, wird öfter mit einem Bauteilschutz gearbeitet. Optimal ist das Aufbringen von Bauteilschutzmaterialien bereits in der Vorfertigung.
Witterungsschutz auf der Baustelle muss bereits bei der Planung beginnen. Die Kosten für den Witterungsschutz sind kalkulierbar – die Kosten für eine Schadensbeseitigung nicht abzusehen.
Holzschutzaspekte am Praxisbeispiel eines modernen Massivholzgebäudes in Dresden
In heutiger Zeit stehen wir beim Neubau von umfangreichen Holzkonstruktionen vor weit größeren Anforderungen als unsere Vorfahren. Grundsätzliche und besondere bauliche Maßnahmen sind in der DIN 68800-2 aufgelistet, deren Umsetzung in der Praxis erfordert umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Planung aller Holzschutzmaßnahmen muss rechtzeitig erfolgen.
 Marlene Brugger und Thomas Kanthak (RKA Architekten Dresden) berichteten in ihrem Vortrag zu den Erfahrungen, einen Massivholz-Neubau als Bauleiter und Baubetreuer zu begleiten. Feuchteschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, Umweltschutz, Klimaschutz sind zu beachten. Eine besondere Rolle im Holzhausbau kommt dem Brandschutz zu. Die länderbezogenen Forderungen sind unbedingt zu erfüllen. Die Qualität des Umgangs mit den Massivholzelementen auf der Baustelle hängt im großen Maß vom Witterungsschutz für diese Elemente ab. Somit kann der Feuchteschutz als wichtigster Holzschutz verstanden werden. Regen und Schnee, Feuchteeintrag durch zu hohe Luftfeuchte, fehlende Dämmung, Feuchteeintrag durch andere Gewerke, aber auch Leckagen und Havarien können enorme Probleme und spätere Schäden verursachen. Feuchteschutz kann aber nur ordentlich ausgeführt werden, wenn er auch geplant wurde! Planungsänderungen während der Bauphase führen zu einem vorher nicht kalkulierten erhöhten Aufwand, was Nachfinanzierungen nötig macht. Im Holzbau sollten wasserführende Leitungen nicht in den Fußböden, sondern wegen der besseren Erreichbarkeit in Vorwänden oder Abhangdecken verlegt werden. Wenn zukünftig im Holzhausbau noch mehr Wert auf die Vorfertigung mit gleichzeitiger Beachtung des Bauteilschutzes gelegt wird, wird auch die Qualität der Ausführung verbessert werden und den Erfolg im Holzhausbau gewährleisten.
Marlene Brugger und Thomas Kanthak (RKA Architekten Dresden) berichteten in ihrem Vortrag zu den Erfahrungen, einen Massivholz-Neubau als Bauleiter und Baubetreuer zu begleiten. Feuchteschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, Umweltschutz, Klimaschutz sind zu beachten. Eine besondere Rolle im Holzhausbau kommt dem Brandschutz zu. Die länderbezogenen Forderungen sind unbedingt zu erfüllen. Die Qualität des Umgangs mit den Massivholzelementen auf der Baustelle hängt im großen Maß vom Witterungsschutz für diese Elemente ab. Somit kann der Feuchteschutz als wichtigster Holzschutz verstanden werden. Regen und Schnee, Feuchteeintrag durch zu hohe Luftfeuchte, fehlende Dämmung, Feuchteeintrag durch andere Gewerke, aber auch Leckagen und Havarien können enorme Probleme und spätere Schäden verursachen. Feuchteschutz kann aber nur ordentlich ausgeführt werden, wenn er auch geplant wurde! Planungsänderungen während der Bauphase führen zu einem vorher nicht kalkulierten erhöhten Aufwand, was Nachfinanzierungen nötig macht. Im Holzbau sollten wasserführende Leitungen nicht in den Fußböden, sondern wegen der besseren Erreichbarkeit in Vorwänden oder Abhangdecken verlegt werden. Wenn zukünftig im Holzhausbau noch mehr Wert auf die Vorfertigung mit gleichzeitiger Beachtung des Bauteilschutzes gelegt wird, wird auch die Qualität der Ausführung verbessert werden und den Erfolg im Holzhausbau gewährleisten.
© Harald Urban (Sprecher des Sächsischen Holzschutzverbandes e.V.)
© Fotos: Harald Urban, Ralf Kretschmar, Christine Nieke

